Kind- und jugendorientierte Ganztagsbildung : Datum: Autor: Autor/in: Stephan Lüke
Das Team der Serviceagentur „Ganztägig lernen“ Nordrhein-Westfalen im Institut für soziale Arbeit Münster bündelt in einem Sammelband, was Kinder und Jugendliche von echter Ganztagsbildung erwarten dürfen.
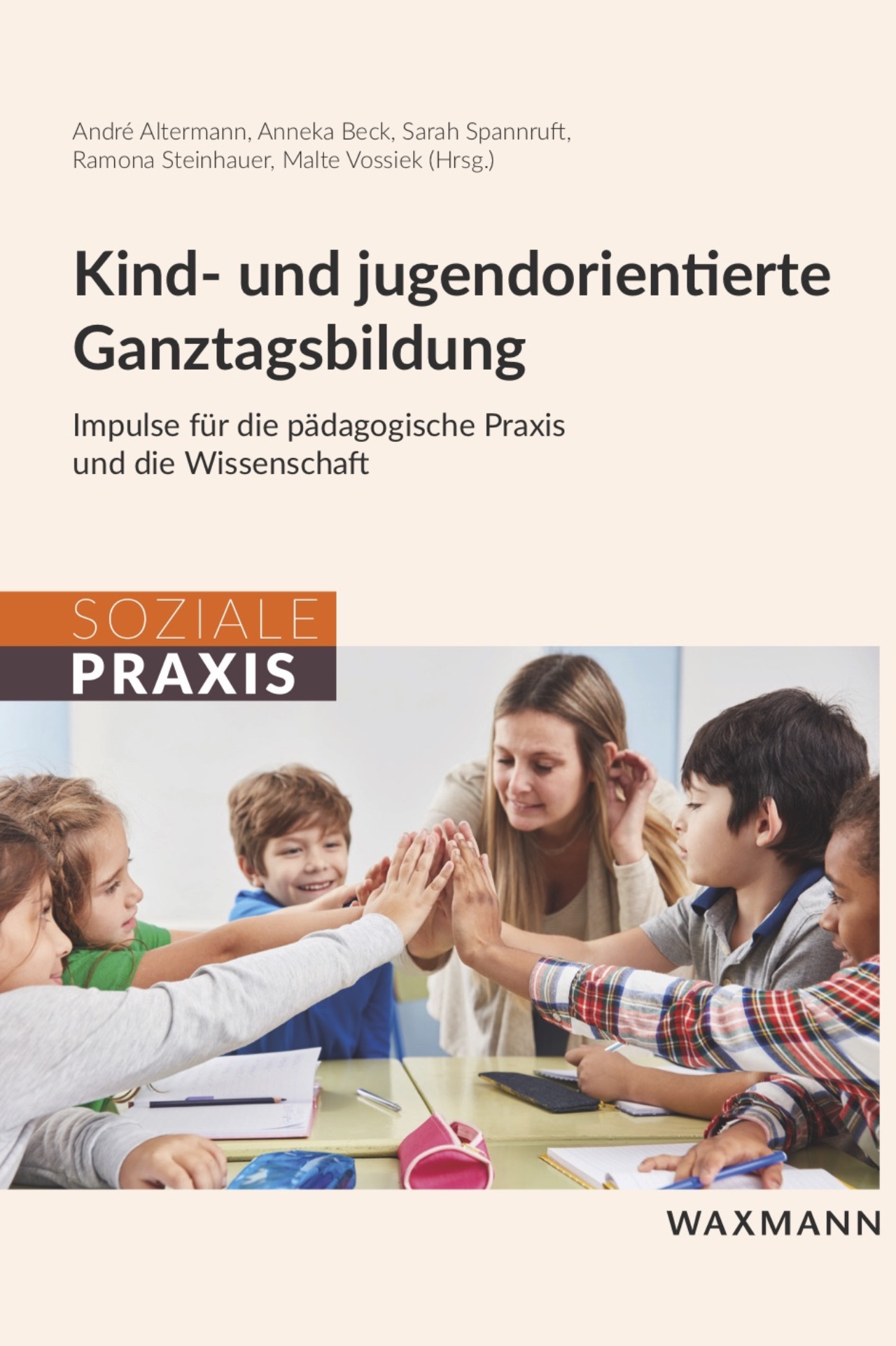
„Das Leitmotiv der kind- und jugendgerechten Ganztagsschule soll für die Entwicklungen der nächsten Jahre handlungsleitend sein“, so Schulministerin Dorothee Feller 2022 im Interview mit www.ganztagsschulen.org über die Schwerpunkte in Nordrhein-Westfalen. Ganztagsbildung, die von den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen ausgeht, ist das Ziel – im engen Austausch von Jugendhilfe und Schule.
Nicht selten ist ein kritischer Blick auf die Ist-Situation der Anlass für eine Bestandsaufnahme. Auch im Fall der vorliegenden Publikation war das so. Der von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Serviceagentur „Ganztägig lernen“ Nordrhein-Westfalen verfasste Sammelband „Kind- und jugendorientierte Ganztagsbildung. Impulse für die pädagogische Praxis und die Wissenschaft“ In der Reihe „Soziale Praxis“ des Instituts für soziale Arbeit Münster war u. a. motiviert durch einen Befund im 15. Kinder-und Jugendbericht (2017): Die Ganztagsschule ließe es „an einer expliziten Jugendorientierung vermissen“ (S. 7).
Diskussionen darüber im Institut für soziale Arbeit, so lässt das Herausgeberteam – André Altermann, Anneka Beck, Sarah Spannruft, Ramona Steinhauser, Malte Vossiek – die Lesenden wissen, führten dann letztendlich zu der Publikation, die Ganztagsbildung „als explizit sozialpädagogisches Bildungskonzept“ versteht, das „deutlich über die Grenzen von (Ganztags-)Schulen hinaus“ weise (S. 8).
Schlüsselthemen der Ganztagsbildung

Was aber, könnten sich Lesende fragen, kann ein solcher Sammelband zu einer schon viel diskutierten Thematik noch Neues bringen? Nun, die Fragen mögen bekannt sein. Aber das Team drängt mit einer klaren Botschaft an die – sicher nicht nur nordrhein-westfälische – Öffentlichkeit: Angesichts des hohen Ausbaustandes der Schulen mit Ganztagsbetrieb in NRW müssen „Ganztagsbildung und die dahinter stehenden Konzepte dem Lebensalter der Adressat:innen angemessen sein oder [sollten] sich an den spezifischen Bedarfen der jeweiligen Lebensphase orientieren“ (S. 7.).
Gleichzeitig wird vor einem vermeintlichen Umkehrschluss gewarnt: Die hohe Inanspruchnahme des Ganztags gerade an den Grundschulen bedeute noch nicht, dass die Ganztagsangebote schon hinreichend zu den Bedürfnissen der Kinder passen. Vielmehr müsse wohl davon ausgegangen werden, dass sich die Frage nach der Passgenauigkeit „angesichts der Vielfalt der in der Praxis angewandten Konzept (…) allgemein wohl nicht zweifelsfrei beantworten lässt“ (S. 7).
Im Mittelpunkt des Sammelbandes steht daher die Frage, welche Strukturen und Haltungen es ermöglichen, dass die erwachsenen Akteurinnen und Akteure im Ganztag erfahren, was Kinder und Jugendliche bewegt. Dieser Fokus erschließt sich direkt in der Einleitung und liefert gleichsam die „Brille“, mit der die nachfolgenden rund 150 Seiten gelesen werden sollten: neun Aufsätze zu Schlüsselthemen der Ganztagsbildung, die konsequent aus der Haltung geschrieben sind, die Perspektive von Kindern und Jugendlichen auf den Ganztag nicht nur konzeptionell stärker zu berücksichtigen, sondern sie auch an jeder einzelnen Schule konsequent sichtbar zu machen.
Zuspitzung und starke Argumente
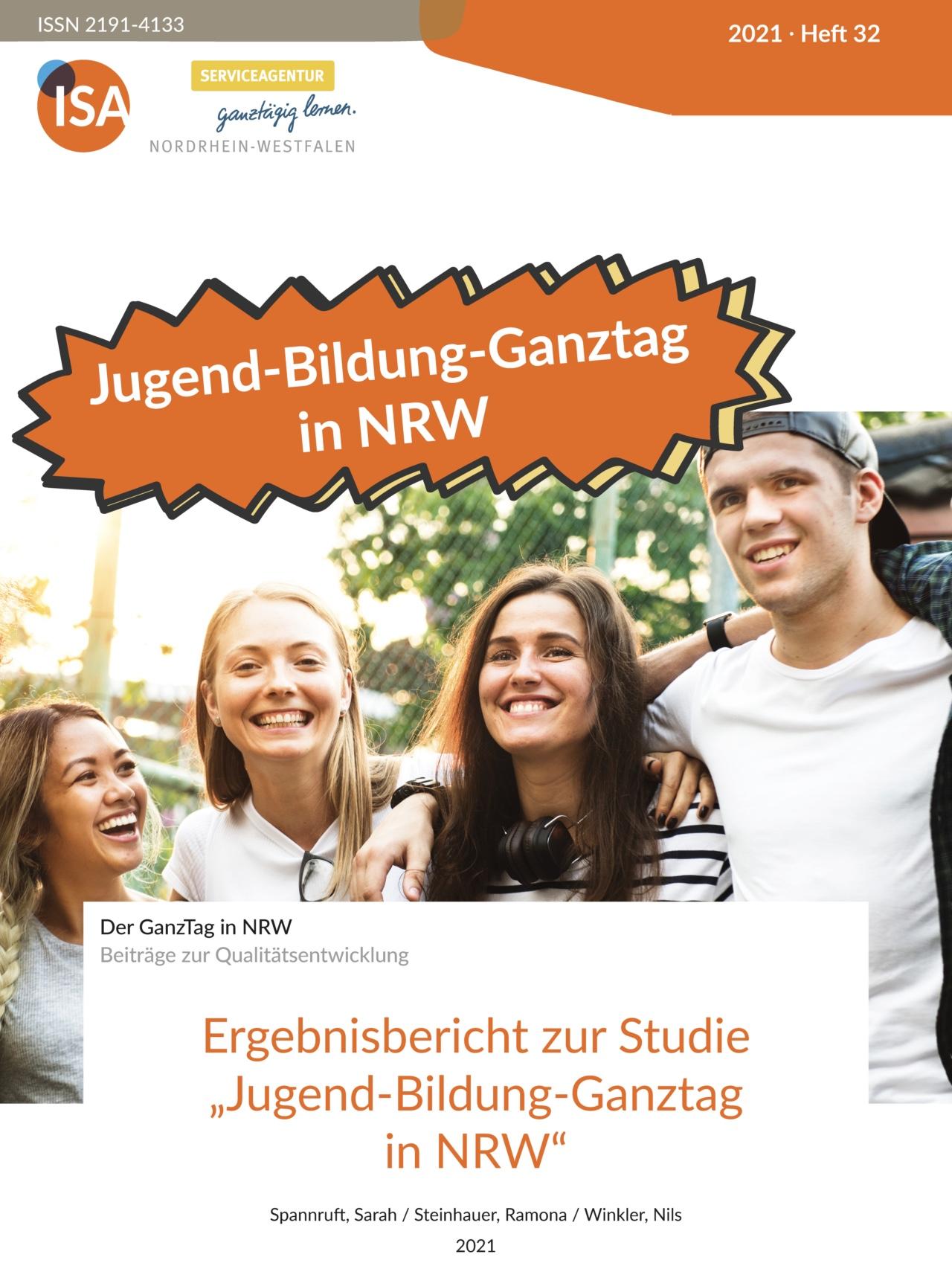
In dieser Zuspitzung zeigt sich der Mehrwert dieses Sammelbandes. Dem Anspruch an eine kind- und jugendorientierte Ganztagsbildung werden in allen Kapiteln gewichtige und ausgewogene Argumente zur Seite gestellt. Dazu gehören Hinweise auf die Rechtsgrundlagen wie etwa die UN-Kinderrechtskonvention, das Sozialgesetzbuch VIII Kinder- und Jugendhilfe oder der Beschluss der KMK zur Stärkung der Demokratieerziehung. Es werden aber ebenso eine Fülle weiterer relevanter wissenschaftlicher Bezüge hergestellt, etwa zur SINUS-Jugendstudie über die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen und der Forschung zum Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen (Sarah Spannruft & Nils Winkler) oder zum Konzept der Sozialraumorientierung (Sarah Spannruft, Malte Vossiek &| Nils Winkler).
Wer also in seinem Arbeitsumfeld starke Argumente braucht, um eine dezidiert kind- und jugendorientierte Ganztagsbildung zu stärken, der wird hier fündig. Auch die Einbettung des Themas in die diversen Bezüge und Spannungsfelder – z. B. individuelle Bedürfnisse versus gesellschaftlicher Funktionen, Arbeitsmarkt- versus Lebensweltorientierung – ist in diesem Sammelband sehr gut gelungen.
Was ist ein Sozialraum?

Ihrem im Untertitel des Bandes formulierten Anspruch, „Impulse für die pädagogische Praxis und die Wissenschaft“ zu geben, dürfte die Publikation durchgängig gerecht werden. Als ein Beispiel sei auf den Aufsatz „Sozialraumorientierung in der Ganztagsschule: Konkrete (erste) Schritte“ verwiesen (S. 83ff.). Hier wird ein fiktiver Entwicklungsprozess einer Ganztagsschule skizziert, der aufzeigt, wie Sozialraumorientierung das Profil einer Schule erweitern kann. Interessant darin das Ringen um ein gemeinsames Verständnis von Sozialraumorientierung, das zwischen einer Verwaltungslogik – z. B. Sozialraum als Planungsgröße für Budgetierung von Leistungen der Jugendhilfe – und den Perspektiven der Kinder und Jugendlichen changiert.
Hier erfahren die Lesenden auch, wie der Sozialraum in der Kinder- und Jugendhilfe verstanden wird und welche Auffassungen und Konzepte von sozialräumlicher Arbeit es gibt. Der seit Jahren populäre Ruf nach Öffnung von Schule in den Sozialraum mit seinem Anspruch der Vernetzung wirkt vor dem Hintergrund dieses Kapitels stellenweise unreflektiert, denn er ignoriert häufig, dass sich eine Schule zunächst einmal stärker auf ihre Kinder und Jugendlichen beziehen muss, um sodann herausfiltern zu können, welche Orte es denn wirklich sind, die deren Lebensrealität prägen.
Individuelle Förderung verlangt „kontinuierliche Aufmerksamkeit“

Überhaupt lassen es die Erörterungen und Querbezüge aller Schlüsselthemen – ob Partizipation oder multiprofessionelle Kooperation, Erziehungspartnerschaften oder Demokratie – nicht zu, sich auf dem, was man in den vergangenen Jahren schon erschöpfend gelesen hat, auszuruhen. Der Sammelband zeigt vielmehr, dass die Debatten zur qualitativen Weiterentwicklung des Ganztags und der Ganztagsbildung keineswegs als abgeschlossen gelten dürfen.
Allein das Kapitel zur „Individuelle Förderung – Chancen ganztägiger Bildung“ von Dirk Fiegenbaum-Scheffner, Melanie Ahrens, Birgit Schröder und Hiltrud Wöhrmann (S. 99 ff) weist nachdrücklich darauf hin, dass individuelle Förderung ihren Namen nicht verdient, wenn sie nicht Schul- und Sozialpädagogik konzeptionell verbindet. Das wiederum „verlangt von pädagogisch Tätigen eine kontinuierliche Aufmerksamkeit und Offenheit gegenüber jedem einzelnen Kind und Jugendlichen“ (S. 74). Beispiele, wie dies gelingt, sind angeführt.
In diesem Zusammenhang sei angemerkt, dass die Lesenden durch ein übersichtliches Layout gut strukturiert durch den Sammelband geführt werden. Beispiele, fokussierte Aussagen, Quintessenzen und Reflexionsfragen sind sorgsam zusammengestellt, optisch hervorgehoben und erleichtern die Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Schlüsselthema.
Fazit

Worum geht es also in einer kind-und jugendorientierten Ganztagsbildung? Wie kann sie gelingen? Die Köllerholzschule in Bochum hat für sich einen kompakten Slogan gefunden: „In der Ganztagsschule geht es um das Ganze. Es kommt darauf an, was man daraus macht““ (S. 60). Das Team der Herausgeberinnen und Herausgeber schlägt vor: Eine „adressatenorientierte Ganztagsbildung [ist] nie als fertiges Konzept zu verstehen, sondern als kontingentes, multiprofessionelles Konstrukt, das sich stets in einem Möglichkeitsraum entfaltet“ (S. 16).
Es bleibt dem Band zu wünschen, dass er Eingang in die pädagogische Praxis findet und dort auf Akteurinnen und Akteure trifft, die die Debatte um kind-und jugendorientierte Ganztagsbildung aufgreifen und diesen Möglichkeitsraum (weiter) öffnen.
Die Übernahme von Artikeln und Interviews - auch auszugsweise und/oder bei Nennung der Quelle - ist nur nach Zustimmung der Online-Redaktion erlaubt. Wir bitten um folgende Zitierweise: Autor/in: Artikelüberschrift. Datum. In: https://www.ganztagsschulen.org/xxx. Datum des Zugriffs: 00.00.0000

