Tatort Hauptschule - Reform-Ort Hauptschule : Datum: Autor: Autor/in: Peer Zickgraf
Zwei denkbar unterschiedliche Ausprägungen von Hauptschulen wurden auf der Tagung "Brennpunkt Hauptschule - Stärkung durch Qualitätsoffensive und Integration" der Friedrich-Naumann-Stiftung am 6. Juni 2006 in Berlin vermessen. Hauptschule als Brennpunkt und Ballungsort erdrückender Probleme und Hauptschule als Ort von Reformen, der die Schule mit dem jeweiligen (Stadt-)Viertel und seinem Lebensumfeld verzahnt.
Sind Hauptschulen noch zu retten? Sind sie wirklich zu gefährdeten Tatorten verkommen, wie dies viele Massenmedien, insbesondere seit die Berliner Rütli-Schule in die Schlagzeilen kam, suggerieren? Dafür sprechen zunächst einige Anhaltspunkte. Die Perspektivlosigkeit unter den Jugendlichen und die Aussicht, sich ohne Ausbildung auf der Straße wiederzufinden. Die geringe Frustrationstoleranz und die hohe Gewaltbereitschaft, der ungezügelte Konsum gewaltverherrlichender Medien, die sich in Hauptschulen konzentrieren. Die ausgeprägte Machokultur jugendlicher Supermänner sowie verarmte und zerrüttete Familienkontexte vieler Kinder und Jugendlicher.
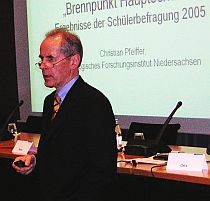
Prügelnde oder renitente, von manchen sogar "unbeschulbar" genannte Jugendliche sind in den Medien zum Inbegriff eines Zustands von Schule geworden, in dem die Polizei eine größere Rolle und Daseinsberechtigung zu haben scheint als die überforderten Lehrerinnen und Lehrer. Hauptschulen sind laut Christian Pfeiffer, Direktor des Kriminologischen Instituts Niedersachsen, zu Ballungsorten all dessen geworden, was die Gesellschaft in dieser oder jener Weise sanktioniert: Soziale Exklusion und offene Gewaltbereitschaft. Ein gefundenes Fressen für viele Massenmedien, die Pfeiffer zufolge ja gerade an der Produktion von Gewaltbereitschaft mitbeteiligt sind.
Hauptschule als soziale Falle
Die Zahlen zu diesem Zustand von Schule stellte Pfeiffer, bekannt durch viele Studien zur Jugendgewalt, einem interessierten Fachpublikum in seinem Vortrag "Aktuelle Forschungsbefunde zur Lebenssituation von Hauptschülern" vor, wobei sein Augenmerk insbesondere dem Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen galt. Demnach verbringen Hauptschüler fast dreimal so viel Zeit vor "entwicklungsbeeinträchtigenden" Computerspielen und Filmen wie Gymnasiasten.
An der Wende zur Sekundarschule sehen Kinder mit Gymnasialempfehlung pro Tag 60 Minuten fern, Kinder mit Hauptschulempfehlung dagegen 132 Minuten. Dazu passt das Phänomen, dass Kinder, in deren Familien es häufig zur Gewaltanwendung kommt, überproportional häufig in die Hauptschule kommen. Mehrfachtäter sind zu 7,4 Prozent Hauptschüler und nur zu 1,9 Prozent Gymnasiasten.
Das Risiko, "an einer Hauptschule Opfer von Gewalt zu werden, ist für Kinder an der Hauptschule um ein Vielfaches höher als in anderen Schulformen", so Christian Pfeiffer, dessen Institut im Jahr 2005 bundesweit 23.000 Viert- und Neuntklässler nach Gewalterfahrungen und Medienkonsum befragt hat. Bei Kindern aus türkischen oder arabischen Familien gibt es die höchste Rate innerfamiliärer Gewalt. Hauptschulen zeigen die höchste Verdichtung einer "Machokultur", das heißt "Gewalt legitimierender Männlichkeitsnormen".
Hauptschulen sind der Untersuchung zufolge auch Brennpunkte der Fremdenfeindlichkeit. Jeder vierte Schüler, dessen Elternteile beide deutscher Abstammung sind, hat eine rechtsextreme Einstellung und ist auch häufiger zur Ausübung von Gewalt bereit. Der jüngste Fall öffentlichkeitswirksamer Gewalt mit postwendendem Polizeieinsatz betrifft eine Prügelei mit acht Jugendlichen an einer Hauptschule in Berlin-Zehlendorf, an der ein Vater eines Schülers beteiligt gewesen sein soll. Der Vorfall ereignete sich am 13. Juni 2006.
Abstimmung mit den Füßen
Dem Tatort Hauptschule wenden immer mehr Eltern den Rücken zu: "Sie stimmen mit den Füßen ab, weil sie wissen, dass ihre Kinder dort schlechte Chance haben", erläuterte Pfeiffer den Tenor vieler Eltern. Manche Eltern mit Migrationshintergrund würden ihre Kinder nur deshalb auf eine Hauptschule schicken, weil sie nicht wissen, was Hauptschule überhaupt bedeutet, und sie keine Informationen darüber besitzen, welche Probleme sie dort erwarten. Dagegen zeichneten sich andere Schülergruppen Migrationshintergrund durch eine hohe Lernmotivation aus, die ihnen den Wechsel in eine andere Schulform, sprich, den erfolgreichen Besuch eines Gymnasiums ermöglicht.
"Alle Schulen in Deutschland müssen Ganztagsschulen werden", so die Forderung des Kriminologen und Sozialpsychologen aus Hannover. Es dürfe keine Aufteilung in Schulen für die Mittelschicht und Schulen für die Unterschicht geben. Kinder aus der Unterschicht müssten statt dessen gerade die Möglichkeit bekommen, zusammen mit Kindern der Mittelschicht zu lernen: "Schluss mit der Aufteilung in Haupt- und Realschule".
Reform-Ort Hauptschule?
Die Suche nach lösungsorientierten Wegen auch innerhalb des "Systems" Hauptschule kennzeichnete das anschließende Expertengespräch am fortgeschrittenen Abend. Nebenbei bemerkt: Auch ein Forschungs- und Nachwuchskolleg an der Pädagogischen Hochschule Freiburg widmet sich bis Oktober 2006 dieser Frage. "Hauptschule kann beides sein: Im ländlichen Raum eine moderne Leistungsschule, die 40 Prozent der Kinder auf ihren Bildungsweg bringt; in Städten auch soziale Brennpunktschule, die von unter 20 Prozent der Kinder besucht wird, als einzige Schulart jedoch mehrheitlich von Jungen. Der Anspruch auf Bildung entzieht der Hauptschule weitgehend ihre herkömmliche Klientel Von den Eltern wünschen nur etwa zehn Prozent eine Hauptschulkarriere für ihre Kinder. Was ist zu tun, um Begabungen und Neigungen der Schüler und Schülerinnen, die in Hauptschulen verblieben sind, möglichst gerecht zu werden?", so lautet die Zielsetzung des Freiburger Projektes.
Was ist zu tun, um speziell die Hauptschulen in Brennpunkten fit für die Organisation von Lern- und Lebensprozessen sozial benachteiligter Schülergruppen zu machen? Unter welchen Voraussetzungen können sie darüber hinaus einen Beitrag für die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund leisten? So lauteten zentrale Fragen der Expertenrunde, die sich im Anschluss an den Vortrag von Christian Pfeiffer artikulierten.
Sechs-Punkte-Katalog für Reformen
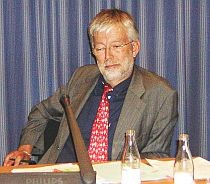
Die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund wird rasant steigen, und deshalb, so Siegfried Arnz, lange selbst Rektor einer Hauptschule, bräuchten die Hauptschulen angemessene Konzepte, die den Bedürfnissen bedürftiger Kinder und Jugendlicher entgegenkommen. Der Leiter der Schulaufsicht Hauptschulen in der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport formulierte sechs Kriterien, die Hauptschulen erfüllen müssten, bevor an eine Zusammenlegung der Schulformen überhaupt gedacht werden könne.
1) Die Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern müssten zu Beteiligten gemacht werden.
2) Das Lernen muss anders organisiert werden hin zu einem individuellen Lernen.
3) Schule braucht eine neue Kultur der gemeinsamen Verantwortung im Stadtteil.
4) Schule muss eine Zukunftsperspektive schaffen, die die Zeit nach der Schule berücksichtigt.
5) Schulen brauchen mehr Professionalität der Handelnden.
6) Schule muss neue Ressourcen erschließen.
Mehr Elterntraining und Partizipation
Vorausgesetzt, dass alle Punkte an den Hauptschulen realisiert werden, ist es für Arnz doch von zentraler Bedeutung, dass die Eltern als Partner gewonnen werden. An den Eltern geht für Eva Schmoll, Lehrerin und Leiterin des Elterntrainings an der Nikolaus-August-Otto-Oberschule, sowieso kein Weg vorbei: "Wir lernen viel von den Eltern, was Schule falsch macht", so die Trainerin. Eine breite Unterstützung der Elternschaft sei wesentlich für die Schule, denn "Eltern leben den Kindern vor, was sie im Leben erwartet". Gegenwärtig trainiere sie 21 Lehrerinnen und Lehrer von 14 Schulen. Da an ihrer Schule doppelt so viele Anmeldungen wie Plätze vorhanden seien, könne man die Eltern dazu bringen, sich für den Besuch eines Elternseminars zu verpflichten, an dem sie zehnmal á zweieinhalb Stunden teilnehmen.
Dass die Elternarbeit an Hauptschulen einen großen Stellenwert hat, hat auch der türkische Elternverein Berlin-Brandenburg erkannt, der sich seit 20 Jahren für einen besseren Dialog zwischen Migrantenfamilien und Schulen einsetzt. Dabei spielen die Sprachförderung und regelmäßige Informationsveranstaltungen eine wesentliche Rolle: "Der Großteil der türkischen Eltern ist sich der Bedeutung des Spracherwerbs bewusst", betonte Tülay Usta vom Türkischen Elternverein. Allerdings fühlten sich immer mehr Migranten als Fremde und nicht integriert: "Wir werden von der Mehrheitsgesellschaft ausgeschlossen", fügte Usta hinzu, und berichtet, dass auch integrationswillige Migranten immer wieder mit Vorurteilen über ihre Herkunft konfrontiert werden.
"Nicht zusehen"
Die Weichen zur Integration oder Exklusion werden bereits früh gestellt. Mieke Senftleben, die für die FDP im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt, stellte fest, dass 25 Prozent der Kinder, die in Berlin eingeschult würden, nicht ausreichend Deutsch könnten. Sie forderte mehr Professionalität bei der Durchführung notwendiger Reformen. Wenn der Staat das Geld besser ausgebe, so Christian Pfeiffer, etwa für kostenlose Kindergärten, dann könne die Integration besser gelingen. Migranten, die sich erfolgreich in die Gesellschaft integrierten, würden dies häufig "Mentoren" in der Schule oder im Umfeld verdanken, das heißt anderen Migranten, deren Integrationsbiographie ihnen Vorbild ist.
Vertrauen und Respekt, darauf machte eine Diskussionsteilnehmerin aufmerksam, und eine positivere Darstellung der Jugendlichen in der Presse seien wichtige Voraussetzungen, damit Schulen besser funktionieren. "Wir sehen zu, wie die Dinge immer schlechter werden", warnte Heinz Buschkowsky, der resolute Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln und selbst ein Kind des Kiezes. Die Probleme des Kiezes seien von ganz anderer Schwere als jene in besser gestellten Vierteln. Buschkowsky forderte flächendeckende Maßnahmen, wie beispielsweise die Ausbildung von "Stadtteilmüttern", die mit Migrantenfamilien arbeiten, aber auch eine "straffere Schuldisziplin".
Zukunftsfeste Hauptschulen?
Da das Bildungssystem gegenwärtig immer stärker daran gemessen wird, inwiefern es auf die Anforderungen der Arbeitswelt vorbereitet, stehen die Hauptschulen unter starken Druck: "Schon Realschüler haben Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu finden", merkte Tissy Bruns, Moderatorin des Abends und Redakteurin des Berliner "Tagesspiegel" an. Diesen Eindruck bestätigte der Unternehmer Volker Grünwold. Als sein mittelständisches Unternehmen, die Firma Aktiv-Kabel in Berlin-Neukölln, sich zwecks Nachwuchsförderung an die Schulen wandte, hätten diese sich zunächst gar nicht gerührt. Rund 200 Bewerbungen jährlich würden belegen, dass die Schülerinnen und Schüler enorme Defizite aufweisen. Berlin bräuchte mehr "begeisterungsfähige Schulen" und mehr Engagement.

Ob die Hauptschulen der geeignete Ort für Reformen seien, ließ der Unternehmer aber ebenso offen wie die Mehrzahl der Teilnehmer an der Veranstaltung. Sicher ist nur: Die Hauptschule bleibt so lange ein Brennpunkt , solange die Gesellschaft sich nicht auf die notwendigen Reformen in den Lebens- und Lernbedingungen von Kindern und Jugendlichen einlässt.
Kategorien: Kooperationen - Eltern und Familien
Die Übernahme von Artikeln und Interviews - auch auszugsweise und/oder bei Nennung der Quelle - ist nur nach Zustimmung der Online-Redaktion erlaubt. Wir bitten um folgende Zitierweise: Autor/in: Artikelüberschrift. Datum. In: https://www.ganztagsschulen.org/xxx. Datum des Zugriffs: 00.00.0000

