"Kinder brauchen Kinder" : Datum: Autor: Autor/in: Udo Löffler
Die Patentrezepte für das marode deutsche Bildungssystem sind schnelllebig. Das Schulfach Wirtschaft zum Beispiel ist fast schon Schnee von gestern. Heute sind wieder Werte gefragt. Doch wer soll sie vermitteln? Petra Gerster, ZDF-Moderatorin und Buchautorin ("Der Erziehungsnotstand"), über die Familie als Ort der Bildung, die Vorteile der Ganztagsschule und warum eine Mutter nicht die einzige Bezugsperson im Leben eines Kindes sein sollte.
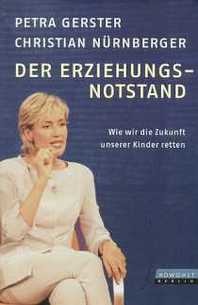
Online-Redaktion: "Business-Pläne zu erstellen scheint heute wichtiger zu sein, als eine Sonate von Mozart zu spielen", stellen Sie in ihrem aktuellen Buch "Stark für das Leben - Wege aus dem Erziehungsnotstand" fest. Was stimmt denn daran nicht, wenn Schüler wirtschaftliche Zusammenhänge kennen lernen?
Gerster: Es ist völlig in Ordnung, wenn Schüler auch wirtschaftliche Zusammenhänge kennen lernen. Sie sollen möglichst viel über möglichst viele Sachgebiete wissen, aber eben nicht nur über Wirtschaft allein. Ich wende mich ja nur gegen die bei uns vorherrschende Tendenz, alles mit der Ökonomenbrille zu sehen. Ich wende mich gegen eine Vorstellung von Schule als Bildungsfabrik, in die man vorne einen Schüler hineinschiebt und hinten einen Siemens-Ingenieur herauszieht, obwohl wir natürlich tüchtige Ingenieure brauchen.
Online-Redaktion: Wie sieht denn Ihre Vorstellung von Bildung aus?
Gerster: Mein Mann und ich orientieren uns am humanistischen Bildungsideal, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Diesen Bildungsbegriff halte ich immer noch für hochaktuell. Ich bin auch überzeugt, dass umfassend gebildete Menschen unsere Wirtschaft wettbewerbsfähiger machen als einseitig nach den Bedürfnissen des Marktes ausgebildete Menschen. Im Gegenteil: Kompetenzen, die heute vom Markt gefordert werden, können schon morgen überflüssig sein. Die Fähigkeit aber, sich auf dem sicheren Boden einer breiten Bildung rasch wechselnden Bedürfnissen anzupassen, die bleibt immer gefragt.
Online-Redaktion: Neben Business-Plänen erleben gerade die so genannten "Werte" eine Renaissance. Lassen sich Toleranz, Ehrlichkeit und Rücksichtnahme wie Vokabeln auswendig lernen?
Gerster: Werte kann man nicht lehren wie Erdkunde oder Physik. Werte müssen in der Familie und in der Schule vorgelebt werden. Werte vermitteln sich aber nicht nur durch das Vorbild der Eltern, sondern durch den Einfluss der gesamten Umwelt, in der sich Kinder bewegen. So beeinflussen Freunde, Lehrer und - nicht zu vergessen - die Medien die Werteskala der Kinder.
Online-Redaktion: In ihrem aktuellen Buch "Stark für das Leben" bezeichnen Sie die Familie als ersten Ort für Bildung. Eltern scheinen dies in den letzten Jahren etwas vergessen zu haben...
Gerster: Das kann man mit Sicherheit so sagen, denn die Zeit, die Eltern mit ihren Kindern in den letzten zwanzig Jahren verbracht haben, ist zunehmend geringer geworden. Andere Dinge spielten in den Familien eine wichtige Rolle: Konsum, Arbeit, Vergnügen. Die intensive Beschäftigung mit Kindern ist stark zurückgegangen und gleichzeitig ist die Tendenz gestiegen, Erziehung zu delegieren, zum Beispiel an die Schulen.
Online-Redaktion: Die konnten diese Aufgabe aber auch nicht bewältigen.
Gerster: Natürlich nicht. Die Lehrer fühlen sich überfordert und haben deshalb diesen Anspruch immer stärker zurückgewiesen. Sie fühlten sich lediglich für die Vermittlung ihres Unterrichtsstoffes verantwortlich und sonst für gar nichts. Das Resultat ist ein Erziehungsvakuum, verstärkt durch den gesellschaftlichen Trend, über Erziehung nicht einmal zu debattieren. Bis zu PISA hatte Erziehung in der öffentlichen Diskussion keinen nennenswerten Raum. Eine verhängnisvolle Entwicklung, denn das hat zu einer Laisser-Faire-Haltung geführt, die von den Eltern nicht die Verantwortung einforderte, die sie tatsächlich tragen. Daran wollten wir mit unserem ersten Buch "Der Erziehungsnotstand" vor zwei Jahren auch erinnern: Dass Eltern eine große Verantwortung tragen, wenn sie Kinder in die Welt setzen, und diese auch wahrnehmen müssen.
Online-Redaktion: Viele Politiker entdecken neuerdings die Kindertagesstätten auch als Ort der Bildung. Warum erkennt man erst jetzt, dass kleine Kinder mehr brauchen als im Sandkasten vor sich hin zu spielen oder Papiersterne auszuschneiden?
Gerster: Man hat's einfach 25 Jahre lang vergessen, weil anderes anscheinend wichtiger war. Jetzt holen uns die Folgen dieses Versäumnisses ein, PISA ist nur ein Symptom dafür. Jetzt lernen wir auch, dass Kindertagesstätten eine sehr große Rolle spielen, allerdings bislang völlig unterschätzt wurden. Gerade in den postfaschistischen Staaten wie Spanien, Italien, Österreich, Japan und Deutschland, so habe ich neulich gelesen, ist die Mutterideologie besonders ausgeprägt, unter der wir zu leiden haben. Diese Mutterideologie hat dazu geführt, dass wir das Problem der Vereinbarkeit von Familie und Beruf völlig verschlafen haben - an erster Stelle die Politik. Deswegen haben wir nicht dafür gesorgt, dass Kinder ausreichende Bildungschancen bekommen - durch eine sehr gute Förderung und Betreuung über den ganzen Tag und zwar von klein auf.
Online-Redaktion: Betreuung über den ganzen Tag ist ein Thema, das ideologisch aufgeheizt diskutiert wird. Den einen geht es bei Ganztagsschulen um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und für die anderen sind es "staatliche Verwahranstalten". Was sind sie denn nun?
Gerster: Was sie sind oder werden, hängt davon ab, wie man sie gestaltet. Kinder brauchen in erster Linie andere Kinder, um zu lernen. Nur in der Gruppe lernen Kinder soziales Verhalten und Tugenden wie Rücksichtnahme und kommunikative Kompetenz. Aber auch Kreativität gedeiht mit anderen Kindern besser, weil sie sich gegenseitig viel mehr anregen als eine Mutter, die zu ihrem Kind sagt: "Jetzt lass uns mal basteln". Das ist auch deshalb wichtig, weil wir ja kaum noch Kinder haben. Viele Kinder wachsen völlig vereinzelt auf und kommen teilweise nur einen Vormittag mit anderen Kindern in Berührung. Außerdem haben sie in den ersten Lebensjahren außer ihrer Mutter oft nur mit Erzieherinnen und Lehrerinnen zu tun.
Online-Redaktion: Was sagen sie zu dem Vorwurf der Ganztagsschul-Kritiker, Eltern wollten ihre Kinder abschieben?
Gerster: Das stimmt so überhaupt nicht. Ganztagsbetreuung heißt ja nicht, dass sich Familien weniger um ihre Kinder kümmern. Familienforscher haben festgestellt, dass sich berufstätige Eltern de facto nicht weniger um ihre Kinder kümmern als bei der klassischen Rollenverteilung zwischen Hausfrau und Mutter und dem alleinverdienenden Mann. Denn natürlich verbringt auch eine Hausfrau nicht den ganzen Nachmittag mit ihren Kindern. Eine Mutter kann einfach nicht all das bieten, was eine Ganztagsschule Kindern anbieten könnte.
Online-Redaktion: Ein Kapitel in ihrem Buch heißt "Wie viel Mutter braucht denn das Kind?". Nach ihren Aussagen zu urteilen gar nicht so viel...
Gerster: Im ersten halben Jahr braucht das Kind sicher ganz viel Mutter, aber es ist ein Trugschluss zu glauben, dass die Mutter die beste und einzige Bezugsperson im Leben eines Kindes ist. Vor allem sollte sie nicht die einzige sein. Kinder mit mehreren Bezugspersonen werden früher selbstständiger, aufgeweckter und wacher. Das heißt konkret, dass neben der Mutter der Vater mindestens eine ebenso große Rolle spielen muss. Kinder brauchen beide Geschlechter als Rollenmodelle. Vielleicht die Jungs noch ein wenig mehr als die Mädchen. Ein Grund für zunehmende Gewalt und Aggressivität unter Jugendlichen sind auch die fehlenden Väter als Autoritätspersonen. Das Kind braucht schon genauso viel Vater wie Mutter. Aber es braucht noch viel mehr: Großeltern, Freunde, Geschwister. Das kann man natürlich nicht alles herzaubern. Das würde das Leben eines Kindes aber definitiv reich machen. Es gibt ja das afrikanische Sprichwort: Für die Erziehung eines Kindes braucht es ein ganzes Dorf. Das wäre der Idealfall - ein groß angelegtes Netz an Beziehungen und nicht die Fokussierung auf die Mutter allein.
Kategorien: Kooperationen - Eltern und Familien
Die Übernahme von Artikeln und Interviews - auch auszugsweise und/oder bei Nennung der Quelle - ist nur nach Zustimmung der Online-Redaktion erlaubt. Wir bitten um folgende Zitierweise: Autor/in: Artikelüberschrift. Datum. In: https://www.ganztagsschulen.org/xxx. Datum des Zugriffs: 00.00.0000

