"Der Kongress macht Mut" : Datum: Autor: Autor/in: Ralf Augsburg
Die Berliner Spreewald-Grundschule war Ausstellerschule auf dem Berliner Ganztagsschulkongress. Als theaterbetonte Ganztagsschule verfügt sie über ein besonderes Profil. Schulleiter Erhard Laube schildert im Interview seine Eindrücke des Kongresses und berichtet von der Herausforderung, in einem schwierigen sozialen Umfeld eine Ganztagsschule zu gestalten.
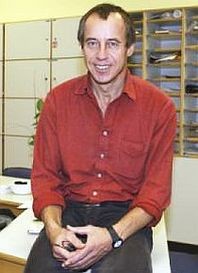
Online-Redaktion: Herr Laube, Ihre Spreewald-Grundschule war Anfang September eine der Ausstellerschulen auf dem Berliner Ganztagsschulkongress. Wie hat Ihnen der Kongress gefallen?
Laube: Gut, wobei ich die Workshops am besten fand. Es gab eine große Vielfalt an Schulen und damit an Anregungen sowie die Möglichkeit, viele Kontakte zu knüpfen. Ein wichtiger Aspekt eines solchen Kongresses mit vielen Gleichgesinnten ist es, dass er uns in unserer Arbeit ermutigt. Wir haben auf dem langen Weg, eine wirklich gute Schule zu werden, viele Probleme zu überwinden. Da kann ein Kongress ein wichtiger Mutmacher und Impulsgeber sein. Dies habe ich auch von anderen Teilnehmern gehört
Online-Redaktion: Welche Resonanz haben Sie mit Ihrer Schule ausgelöst?
Laube: Ich habe Anfragen für Referate an anderen Schulen erhalten. Viele wollten auch eine Kopie des Filmes haben, den Reinhard Kahl am ersten Kongresstag gezeigt hat.
Online-Redaktion: Was Ihre Schule betrifft, so besuchten im Jahr 2000 nur Migrantenkinder ihre Schule.
Laube: Nein, 2000 hatten wir die Situation, dass in den drei ersten Klassen keine Schülerinnen und Schüler mit deutscher Muttersprache mehr saßen.
Online-Redaktion: Da kann man nicht mehr von einer realistischen Abbildung der Lebenswirklichkeit sprechen.
Laube: Man kann vor allem nicht von Integration sprechen, auch nicht von Heterogenität, die sich auch Eltern von Schülern nichtdeutscher Herkunft für ihre Kinder wünschen. Sie wissen, wie wichtig der gemeinsame Unterricht mit deutschsprachigen Kindern ist. Man muss nicht die PISA-Studie gelesen haben, um zu wissen, dass der ungesteuerte Spracherwerb von besonderer Bedeutung ist. Für Kinder ist es enorm wichtig, dass nicht nur der Lehrer Sprachvorbild ist. Kinder lernen vor allem durch Gespräche miteinander Deutsch. Wenn aber niemand mehr in der Klasse sitzt, der weiß, ob es "der", "die" oder "das" Apfel heißt, dann reicht es nicht aus, dass Deutsch die Kommunikationssprache ist.
Online-Redaktion: Was hat Ihre Schule unternommen, um wieder mehr deutsche Kinder in die Klassen aufzunehmen?
Laube: Meine Kolleginnen und Kollegen und ich haben sämtliche Kitas der Umgebung aufgesucht, um uns von den Eltern das Bild unserer Schule vermitteln zu lassen. Dies war ein überwiegend negatives. Wir hatten den Ruf als "Ausländerschule" mit hoher Gewaltbereitschaft und geringem Leistungsniveau. Viele deutsche Eltern erwogen überhaupt nicht, auch nur einen Fuß in unsere Schule zu setzen. Wir haben daraufhin versucht, für uns zu werben, indem wir Eltern einluden und eine Homepage erstellt haben. Mit Mitteln des Quartiersmanagements drehten wir einen Film über unsere Schule, der einigen Eltern die Ängste nahm - sie sahen nämlich viel Schönes. Durch diese Mischung aus Dokumentar- und Werbefilm wurden manche doch neugierig auf die Spreewald-Grundschule.
Online-Redaktion: Reichte das aus, um wieder zu einem Gleichgewicht in den Klassen zu gelangen?
Laube: Zu Beginn sagten die Eltern, sie wollten nicht, dass ihr Kind in eine Klasse komme, in der nur zwei oder drei weitere deutschsprachige Kinder säßen. Diesen Eltern habe ich entgegnet, wenn sie sich auf das Abenteuer Spreewald-Grundschule einließen, würde ich ihnen garantieren, dass ihre Kinder in eine Klasse mit mehrheitlich deutschsprachigen Schülerinnen und Schüler kämen. Falls es nicht gelingen sollte, genügend deutschsprachige Kinder an die Schule zu holen, sagte ich den Eltern zu, dass an Nachbarschulen Plätze für ihre Kinder reserviert würden. Im ersten Jahr hat es dann tatsächlich nicht gereicht: Es kamen nur acht deutsche Kinder. Die Eltern haben sie dennoch an der Spreewald-Grundschule gelassen und sind bis heute zufrieden.
Online-Redaktion: Wie sieht die Zusammensetzung der Klassen heute aus?
Laube: In zwei der vier neuen ersten Klassen dieses Schuljahrs spricht die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler Deutsch als Muttersprache. Von dem Ziel, in allen Klassen eine Fünfzig-fünfzig-Mischung zu erreichen, sind wir noch ein ganzes Stück entfernt. Unser Problem ist dabei, dass in unserem Einzugsbereich im Schöneberger Norden praktisch überhaupt keine deutschsprachigen Kinder wohnen. Die Schülerinnen und Schüler mit deutscher Muttersprache müssen alle aus anderen Einschulungsbereichen kommen und längere Schulwege in Kauf nehmen.
Meiner Ansicht nach versagt hier aber auch die Schulverwaltung. Ich kenne Eltern nichtdeutscher Herkunft an unserer Schule, die ihre Kinder gerne an Nachbarschulen mit geringerem Migrantenanteil unterbringen würden, und umgekehrt weiß ich von deutschsprachigen Eltern dieser Nachbarschulen, die ihre Kinder gerne bei uns einschulen würden. Da ist unser Träger, das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, aber zu unflexibel. Er schafft es nicht, diesen Tausch zu ermöglichen, geschweige denn zu organisieren.
Online-Redaktion: Seit dem 1. März 2004 ist die Spreewald-Grundschule Ganztagsschule. Erleichtert Ihnen das das Werben in der Elternschaft?
Laube: Grundsätzlich ja. Allerdings sind hier im Schöneberger Norden fast alle Schulen Ganztagsschulen geworden. Der Träger hat sich bei der Überlegung, an welchen Standorten Ganztagsschulen eingerichtet werden sollten, nicht nur von pädagogischen Gesichtspunkten leiten lassen, sondern auch Schulen aufgefordert, sich als Ganztagsschule zu melden, weil dort sowieso Renovierungsarbeiten anstanden und man dann dank des Bundeszuschusses Geld sparen konnte.
Online-Redaktion: Wie machen Sie sich als Ganztagsschule von den anderen unterscheidbar?
Laube: Uns hat sehr stark das Theaterprofil geholfen, das macht uns attraktiv. Das Theaterspielen unterstützt den ganzheitlichen Spracherwerb: Kinder lernen Mimik, Gestik und das gesprochene Wort als eine Einheit zu begreifen. Die Sprachkompetenz setzt sich aus dieser Gesamtheit zusammen. Außerdem eignet sich das Theater sehr gut für interkulturelle Ansätze. Wir arbeiten an zweisprachigen Theaterstücken oder führen Stücke auf, die zum Beispiel in arabischen Ländern oder der Türkei spielen. Im Ganztagsbereich können wir die Theaterarbeit natürlich umfassender konzipieren: In den Arbeitsgemeinschaften kann nicht nur zusätzlich geprobt werden, sondern man baut auch Kulissen und schneidert Kostüme.
Online-Redaktion: Ganzheitliches Lernen und Erziehen sollte ja auch die Lebenswelt, also auch außerschulische Partner, einbeziehen. Kommen Impulse aus der Nachbarschaft in ihre Schule?
Laube: Seit fünf Jahren arbeiten wir erfolgreich mit dem Puppentheater Hans Wurst Nachfahren zusammen, das nebenan am Winterfeldtplatz seine Bühne hat. Zwei Schauspieler von dort beraten uns konzeptionell und arbeiten in den Theaterprojekten mit. Die Einbeziehung von Profis stärkt natürlich die Qualität unserer Theaterstücke. Wir machen auch bei einem Tanztheaterprojekt mit, einem Nachfolgeprojekt von "Rhythm Is It!" mit. Eine Theaterpädagogin, die wir aus Sponsorengeldern finanzieren, arbeitet schon mit den ersten Klassen an kleinen Theaterstücken, unterstützt aber auch unsere "Theaterlehrer" professionell.
Darüber hinaus haben wir mit Mitteln des Quartiersmanagements eine Lehrkraft aus dem Irak angestellt, die arabischstämmigen Kindern auf freiwilliger Basis in Arabisch unterrichtet und die mit arabischen Eltern Gespräche in unserem schuleigenen Café führt: Auf welche Oberschule soll ich mein Kind schicken, wie gehe ich in der Pubertät mit ihm um? Dadurch wird auch eine Brücke zu Eltern geschlagen, die sonst allein schon wegen der Verständigungsschwierigkeiten Hemmungen hätten, in die Schule zu kommen.
Online-Redaktion: Sie streben eine engere Einbindung der Eltern in Ihre Schule an?
Laube: Ja, wir bemühen uns sehr stark um eine intensive Elternarbeit. Das Schulcafé dient dabei als Kommunikationsort, der allen offen steht. Es ist von 7.00 bis 16.00 Uhr geöffnet, und oft treffen sich dort Eltern, die ihre Kinder gerade zur Schule gebracht haben. Das Café wird von acht Müttern ehemaliger Schülerinnen und Schüler betrieben. Ihre Arbeit wird mit Stiftungsgeldern honoriert. Dadurch, dass es Mütter sind, die dort tätig sind, verringert sich natürlich auch die Schuldistanz der Eltern. Diese können dort Kontakte knüpfen und sich informieren. Die Bereitschaft zur Mitarbeit von Eltern ist dabei weniger eine Frage der ethnischen, sondern eher der sozialen Herkunft. Eltern aus bildungsfernen Schichten sind sehr viel schwerer zur Mitarbeit zu motivieren.
Online-Redaktion: Wie finanzieren Sie die außerschulischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Laube: Zuerst erhielten wir Gelder des Senators für Stadtentwicklung, die für Arbeit in sozialen Brennpunkten gedacht, aber nicht als Dauerfinanzierung angelegt war. Jetzt stellen wir häufig Anträge auf Unterstützung für bestimmte Projekte bei Stiftungen. Aktuell haben wir bis zum Sommer, vielleicht auch länger, einen privaten Sponsor gewonnen. Es gibt viel Geld, man muss aber die Bereitschaft der Stiftungen und Organisationen wecken, dieses Geld auch zur Verfügung zu stellen. Das macht viel Arbeit, bis die Förderungswürdigkeit anerkannt ist und das Geld fließt.
Online-Redaktion: Die Entscheidung, Ganztagsschule zu werden, ist von Ihrem Kollegium einstimmig gefällt worden. Wie sehen die Lehrerinnen und Lehrer nach eineinhalb Jahren Arbeit die Situation?
Laube: Die pädagogischen Erfolge der Ganztagsschule werden wahrgenommen und sind unbestritten. Gleichzeitig kommen die Kolleginnen und Kollegen mit der erhöhten Arbeitsbelastung unterschiedlich zurecht. Einige ziehen den Karren, andere lassen sich ziehen - was normal ist. Bei grundsätzlichen Entscheidungen setzt sich aber bei allen das pädagogische Ethos durch.
Online-Redaktion: Welche pädagogischen Erfolge der Ganztagsschule können Sie festmachen?
Laube: Bei Migrantenkindern hat sich die Sprachkompetenz verbessert, aber auch das Sozialverhalten. Die Schülerinnen und Schüler lösen ihre Konflikte nun eher verbal und finden zu einem stärkeren Verantwortungsbewusstsein. Ein wichtiger Bestandteil unseres Ganztagsschulkonzepts ist die Partizipation der Schülerschaft. Die Beschlüsse des Schülerparlaments sind weitgehend bindend. Wir versuchen, den Kindern viele Aufgaben zu übertragen und ihnen zu vermitteln: "Das ist eure Schule, und ihr könnt Verantwortung übernehmen." Das hat dazu geführt, dass es an unserer Schule nur wenige Zerstörungen und Graffitis gibt.
Online-Redaktion: Ein schwieriges Thema in Berlin ist die Qualität der Schulessen. Wie sieht es an Ihrer Schule damit aus?
Laube: Wir hatten einen Caterer, der ausgesprochen schlechte Qualität mit Geschmacksverstärkern und nicht deklarierten genveränderten Bestandteilen geliefert hat. Bei dessen Mitarbeitern hatten wir den Eindruck, dass sie geringe Sensibilität für die Probleme einer Schule im sozialen Brennpunkt mit einem hohen Migrantenanteil hatten. Es reicht ja nicht aus, auf Schweinefleisch zu verzichten. Mit Eltern, die oft nicht lesen können, muss man auch mal reden und telefonieren, um an sein Geld zu kommen.
Jetzt kocht bei uns ein Caterer, der völlig auf Geschmacksverstärker und weitgehend auf Tiefkühlkost verzichtet und viel Gemüse anbietet. Die Schule hat sich nach Beratung durch die Vernetzungsstelle Gesunde Schulerverpflegung zusammen mit diesem Anbieter auf Qualitätsstandards geeinigt. Den Kindern schmeckt es, und die Eltern sind zufrieden. Ich kann nur allen Schulen empfehlen, sich selbst den Essensanbieter auszusuchen und keinen vorsetzen zu lassen!
Online-Redaktion: Wie organisieren Sie die Essensausgabe?
Laube: Auch da haben wir etwas verändert. Da wir sowieso über keine große Mensa verfügen, essen wir in vier Räumen. Das führt zu weniger Gedrängel und Lautstärke. Es gibt mehr Zeit und Überschaubarkeit. Wir bieten keine Wahlessen mehr an, da das nur zu Problemen geführt hatte. Das Essen wird auch nicht mehr zentral ausgegeben, sondern kommt in Schüsseln auf den Tisch. Die Schülerinnen und Schüler bedienen sich selbst - so wie es in einer Familie üblich ist. Das sind ganz wichtige pädagogische Aspekte: Die Kinder lernen, sich gegenseitig etwas anzubieten, mit dem Nachtisch zu warten, bis andere mit dem Hauptgang fertig sind, zusammen aufzuräumen und zu putzen. Das fördert auch den Gruppenzusammenhalt.
Online-Redaktion: Wie viel kostet bei Ihnen ein Mittagessen?
Laube: 1,95 Euro, also rund 42 Euro monatlich.
Online-Redaktion: Schreckt diese Summe finanziell schwächere Familien ab, ihre Kinder bei Ihnen anzumelden?
Laube: Hier in Berlin hat der Gesetzgeber die Teilnahme am Essen für nicht verpflichtend erklärt. Das halte ich für sehr schlecht: Aus meiner Sicht gehört zum Besuch einer Ganztagsschule ein gesundes, obligatorisches Mittagessen dazu. Deshalb erkläre ich den Eltern, dass der Ganztagsschulbetrieb ein Essen einschließt und es nicht ausreicht, den Kindern eine Stulle mitzugeben. An unserer Schule hat das bislang funktioniert, und niemand hat sein Kind wegen der Essenskosten abgemeldet. Nach Gesprächen mit dem Schulsenator und der Schulverwaltung habe ich den Eindruck, dass aber auch dort ein Umdenken begonnen hat und das Essen zu einem verpflichtenden Teil des Ganztagsbetriebs gemacht werden soll.
Ein weiteres Problem in Berlin ist, dass Eltern von Kindern, die am Ganztagsunterricht, aber nicht an Früh- und Ferienbetreuung teilnehmen, einen privatrechtlichen Vertrag mit dem Caterer über besagte 42 Euro monatlich abschließen müssen. Bei den anderen Eltern ist der Essensvertrag Bestandteil ihres Vertrages mit dem Bezirksamt, und sie zahlen nur 23 Euro im Monat. Unter dem Strich kommen diese Eltern unter Umständen günstiger weg, obwohl ihre Kinder noch Früh- und Ferienbetreuung wahrnehmen. Das ist keinem Elternteil verständlich zu machen und muss sicherlich korrigiert werden.
Online-Redaktion: Was halten Sie zudem für verbesserungswürdig an der Berliner Ganztagsschulpolitik?
Laube: Es sollte darüber nachgedacht werden, ob nicht die Raumausstattung von Ganztagsschulen verbessert wird. Meine Schule ist da eher die Ausnahme - ich kenne aber viele Schulen, wo bessere pädagogische Konzepte an unzureichender Raumausstattung scheitern. Aus meiner Sicht wäre es zudem ganz wichtig, die Kooperation von Lehrern und Erziehern institutionell zu verankern und Zeit für Teamsitzungen zur Verfügung zu stellen, denn das A und O einer funktionierenden Ganztagsschule ist die gelungene Kommunikation zwischen Lehrkräften und Erzieherinnen als Voraussetzung für eine neue Lernkultur.
Kategorien: Kooperationen - Eltern und Familien
Die Übernahme von Artikeln und Interviews - auch auszugsweise und/oder bei Nennung der Quelle - ist nur nach Zustimmung der Online-Redaktion erlaubt. Wir bitten um folgende Zitierweise: Autor/in: Artikelüberschrift. Datum. In: https://www.ganztagsschulen.org/xxx. Datum des Zugriffs: 00.00.0000

