15 Jahre StEG: „Wo also steht die Ganztagsschule?“ : Datum: Autor: Autor/in: Ralf Augsburg
Mit der „Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen“ (StEG) wurde ein ehrgeiziges Vorhaben langfristig begleitet und breit erforscht: der Ausbau der Ganztagsschule in Deutschland. Eine Bilanz nach 15 Jahren.

Es begann mit einem Besuch. Ein Ministerialdirigent des Bundesministeriums für Bildung und Forschung reiste 2004 nach Frankfurt am Main zum damaligen Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF). Das Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“ (IZBB) der Bundesregierung musste durch Begleitforschung flankiert werden, um langfristig Antworten auf die Frage zu geben, ob und wie Ganztagsschulen mit vielfältigen Angeboten die Bildung verbessern: nicht nur Schülerleistungen, sondern auch die Lehr- und Lernkultur.
Die PISA-Studien hatten gezeigt, wie sehr in Deutschland der Bildungserfolg von der sozialen Herkunft abhing. Als eine Ursache galt vielen die Halbtagsschule, die Bildung wesentlich in die Familie verlagerte, ob als Hausaufgaben oder als zusätzliches Bildungsangebot nach dem Motto „Wer hat, dem wird gegeben“. Schließlich war absehbar, dass eine neue, gut ausgebildete Generation zunehmend auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf drängte – in vielen Ländern längst selbstverständlich.
Ein Rückblick

„Es war mutig vom BMBF, systematische Wirkungsforschung zu fördern, trotz einer im Vorfeld unternommenen ernüchternden Literaturanalyse“, erinnert sich Prof. Eckhard Klieme. Es war der Startschuss für eine 15 Jahre währende Ganztagsschulforschung in mehreren Förderphasen: von 2005 bis 2011 mit einer großen Befragung aller an Ganztagsschule Beteiligten, anschließend von 2012 bis 2019 mit bundesweiten Schulleitungsbefragungen und vertiefenden Teilstudien.
Am 8. November 2019 kamen mit Prof. Eckhard Klieme vom DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, Prof. Heinz Günter Holtappels vom Institut für Schulentwicklungsforschung an der TU Dortmund und Prof. Ludwig Stecher von der Justus-Liebig-Universität Gießen drei der vier Mitglieder des StEG-Konsortiums, zu dem noch Prof. Thomas Rauschenbach vom Deutschen Jugendinstitut München gehört, im Tagungswerk Berlin zusammen. Mit den beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern galt es, für rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 15 Jahre StEG-Forschung zu bilanzieren: „Entwicklung von Ganztagsschulen – was wir aus 15 Jahren Forschung lernen“.
Entscheidend ist die Ausgestaltung des Ganztags vor Ort

Dass die Antworten auf die im Raum stehenden Fragen bezüglich des Ertrages und des Mehrwerts von Ganztagsschulen nicht schlicht ausfallen, wurde auf der Bilanztagung deutlich. Ministerialdirigent Dr. Stefan Luther vom Bundesministerium für Bildung und Forschung brachte es in der Begrüßung auf den Punkt: „Bei der Forschung ist es ein bisschen so, wie wenn man einen Juristen fragt. Man bekommt oft zur Antwort: Es kommt darauf an...“ Entscheidend für die Wirksamkeit einer Ganztagsschule, so schlussfolgerte er, sei die konkrete Ausgestaltung vor Ort. Dafür gab es später viele Belege.
Es war an Prof. Ludwig Stecher, „zentrale Befunde und offene Fragen“ der Studie zusammenzufassen. Der empirische Bildungsforscher stieg mit einer Frage ein: „Warum erwarten wir einen pädagogischen Mehrwert von Ganztagsschulen?“ Und er gab die Antwort gleich selbst: „Weil sie das Zeug dazu hat!“ Der Ganztag biete zusätzliche musisch-kulturelle und sportliche Angebote, Hausaufgabenbetreuung beziehungsweise Lernzeiten, Angebote zu neuen Medien und mehr. Personell öffne sich die Ganztagsschule – ein Novum – für neue Professionen.

Methodisch erweiterten sich die Arbeitsweisen durch zusätzliche Lernangebote und Arbeitsgemeinschaften. „Unsere Befragungen haben gezeigt, dass die Schülerinnen und Schüler gerade in den Angeboten etwas Besonderes wahrnehmen“, berichtete der Forscher, der von 2005 bis 2014 der Koordinator der Studie war. Strukturell würden sich in Ganztagsschulen mehr Gelegenheiten für Partizipation, Öffnung von Unterricht, Altersmischung und freiwillige Teilnahme bieten.
„Ein Projekt, das es wert war und ist“
Quantitativ hat die Ganztagsschule enorm gewonnen: Knapp jeder zweite Schüler beziehungsweise jede zweite Schülerin besucht heute eine Schule mit Ganztagsangebot. Die Teilnehmerzahlen sind stabil hoch und die Nachfrage nach weiteren Plätzen besteht weiter, insbesondere im Primarbereich. Eine Verbesserung der Lernleistungen zeige sich dann, „wenn die pädagogische Qualität der Angebote und die Teilnahmeintensität hoch sind“, erklärte Ludwig Stecher. Allein die sporadische Teilnahme an den Angeboten bewege in dieser Hinsicht wenig.

Teilstudien wie StEG-P und StEG-S hätten gezeigt, dass die Lernleistungen steigen, wenn sich Schülerinnen oder Schüler freiwillig aus Interesse für das Angebot entscheiden und „wenn die Angebote kompetenz-orientiert entwickelt wurden“. Das soziale Lernen verbessere sich durch die dauerhafte Teilnahme an Ganztagsangeboten und wenn Autonomie- und Kompetenzunterstützung hoch seien.
Oft noch unzureichend und damit kritisch zu sehen sei die Verbindung von Unterricht und Ganztagsangeboten. Auch in der Unterrichtsentwicklung gebe es noch viel Luft nach oben, wie der Wissenschaftler betonte. Und schließlich: „Die Öffnung von Schule ist kein Selbstläufer. Der Austausch zwischen Lehrkräften und dem weiteren pädagogisch tätigen Personal findet nur bedingt statt.“ Grundsätzlich positive Wirkungen habe die Ganztagsschule indes bei den Familien bewirkt, denn viele Eltern fühlen sich besonders mit Blick auf die Hausaufgaben entlastet.
Wo also steht die Ganztagsschule? „Sie ist ein Projekt, das es wert war und ist“, folgerte Ludwig Stecher. „Sie wird akzeptiert und zeigt positive Wirkungen, bei Schülerinnen und Schülern ebenso wie für Eltern.“ Eine neue Lehr- und Lernkultur entwickele sich oft langsamer, vor allem der „multiprofessionelle Austausch“ und die didaktische Verknüpfung der Angebote – vom Unterricht bis zu den AGs. Stecher zeigte sich überzeugt: „Die Ganztagsschule ist für mich keine Strukturfrage, keine grundsätzliche Frage von offen oder gebunden, sondern eine Frage der Qualität in der Einzelschule.“
Die Teilprojekte und kontroverse Themen

Die Fachtagung bot den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch Gelegenheit, in Workshops die Ergebnisse der aktuellen Teilstudien „StEG-Lesen“, „StEG-Kooperation“, „StEG-Tandem“ und „StEG-Bildungsorte“ zu diskutieren. Zusätzlich fanden Foren zu kontroversen Themen der Ganztagsschule statt. Als langjährige StEG-Forscherinnen und -Forscher stellten Prof. Ivo Züchner (Philipps-Universität Marburg) das Thema „Ganztagsschulausbau und soziale Teilhabe“, Prof. Natalie Fischer (Universität Kassel) „Individuelle Förderung“ und Prof. Heinz Günter Holtappels „Qualität und Entwicklung von Ganztagsschulen“ vor.
Dr. Christine Steiner vom Deutschen Jugendinstitut München widmete sich im vierten Forum dem Thema „Multiprofessionelle Kooperation und Kooperationspartner“. Sie konnte resümieren: „Die Debatten um Multiprofessionalität haben abgenommen, die Vorteile scheinen erkannt zu werden." Die Schulleitungsbefragung 2017/2018 habe aber beispielsweise die Probleme der Stellenbesetzung gezeigt. Auch gibt es inzwischen Ganztagsschulen, die mit wenigen oder keinen Kooperationspartnern arbeiten.

In den Angebotsstrukturen sieht Steiner einen „strukturellen Konservatismus“, der Ganztagsbereich orientiere sich oft an etablierten Formen: Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung, Sport und Musik. Doch sie vermutet auch, dass der Ganztag gerade damit schnell die Akzeptanz der Eltern gewonnen habe. Als größtes Defizit sieht sie, dass die Ganztagsschule jetzt erst allmählich ein Thema der Ausbildung werde, der Lehrerbildung ebenso wie der Ausbildung sozialpädagogischer Fachkräfte.
Als Schulleiterin mutig sein
Die abschließende Diskussion versammelte Praxis, Politik, Verbände und Wissenschaft auf dem Podium: Für die Praxis sprach Ute Waffenschmidt, Schulleiterin der Hupfeldschule Kassel, einer Ganztagsgrundschule. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung als Förderer der Studie war durch Dr. Stefan Luther, Leiter der Unterabteilung „Allgemeine Bildung“ vertreten. Anna Davis sprach für das von 2004 bis 2015 vom Bund geförderte Begleitprogramm „Ideen für mehr! Ganztägig bilden“, das seit 2016 von den Ländern weitergeführt wird. StEG-Forscher Dr. Markus Sauerwein konnte schließlich noch einmal pointiert Forschungsergebnisse zusammenfassen.
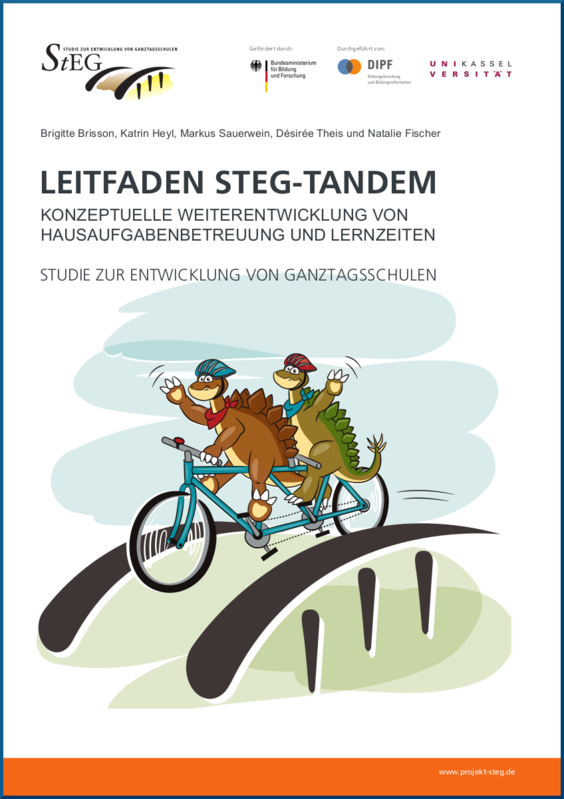
Die Praxis, auf die es nach einhelliger Auffassung ankommt, soll hier das Schlusswort haben: „Ganztagsschule ist mein Steckenpferd“, bekannte Schulleiterin Ute Waffenschmidt, die seit fünf Jahren die Hupfeldschule leitet, an der erstmal „keiner wollte, dass sich was verändert“. Sie führte die Grundschule schließlich in den hessischen „Pakt für den Nachmittag“. Heute arbeitet die Mehrheit ihres 16-köpfigen Kollegiums in den Ganztagsangeboten mit.
„Nach meiner Erfahrung brauchen Schulentwicklungsprozesse zehn Jahre. Wir wissen erst jetzt, wo wir genau hinwollen. Als wir vor fünf Jahren starteten, hatten gerade mal zwei Leute an unserer Schule Ahnung vom Ganztag“, lautete ihr Resümee, das auch Erkenntnisse der Forschung bestätigt. Ute Waffenschmidt hat die Entscheidung nicht bereut: „Als Schulleiterin muss man mutig sein, und das bin ich an der Stelle der Einführung der Ganztagsschule mal gewesen.“
Das Kollegium sehe die Effekte deutlich, denn „die Kinder sind jetzt bei uns in der Schule“. Der Ganztag ermögliche viel mehr Aufmerksamkeit für das, was die Schülerinnen und Schülerinnen, auch außerhalb der Schule, bewegt. Nur dadurch sei Unterstützung überhaupt möglich. Sie widersprach für ihre Schule dem Eindruck, dass Lehrkräfte und weiteres pädagogisches Personal zu wenig Austausch hätten. Wichtig sei wechselseitige Wertschätzung und jeden entsprechend seiner Qualifikation einzusetzen. An der Hupfeldschule sind alle in Besprechungen einbezogen und Fortbildungen werden gemeinsam besucht. „Es geht in kleinen Schritten vorwärts“, ermutigte die Schulleiterin.
Kategorien: Ganztag und Grundschule - Qualitätsdialog
Die Übernahme von Artikeln und Interviews - auch auszugsweise und/oder bei Nennung der Quelle - ist nur nach Zustimmung der Online-Redaktion erlaubt. Wir bitten um folgende Zitierweise: Autor/in: Artikelüberschrift. Datum. In: https://www.ganztagsschulen.org/xxx. Datum des Zugriffs: 00.00.0000

